
Abwasserprofis
Warum smarte Städte mehr als nur Technologie brauchen
Mareike Roszinsky / 28. Oktober 2025
Zukunftssichere Städte brauchen Herz und Infrastrukturen. Technologien können, richtig eingesetzt, die Lebensqualität im urbanen Raum verbessern.
Beim Weltstädtetag 2025 (World Cities Day) steht ein zukunftsweisendes Motto im Mittelpunkt: „menschenzentrierte intelligente Städte“. Das ist eine Formulierung, die viel verspricht, aber auch viele Fragen aufwirft.
Denn was bedeutet es eigentlich, wenn Städte „intelligent“ sein sollen? Und wie gelingt es, dabei die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren?
➡️ Technologien können, richtig eingesetzt, die Lebensqualität im urbanen Raum verbessern.
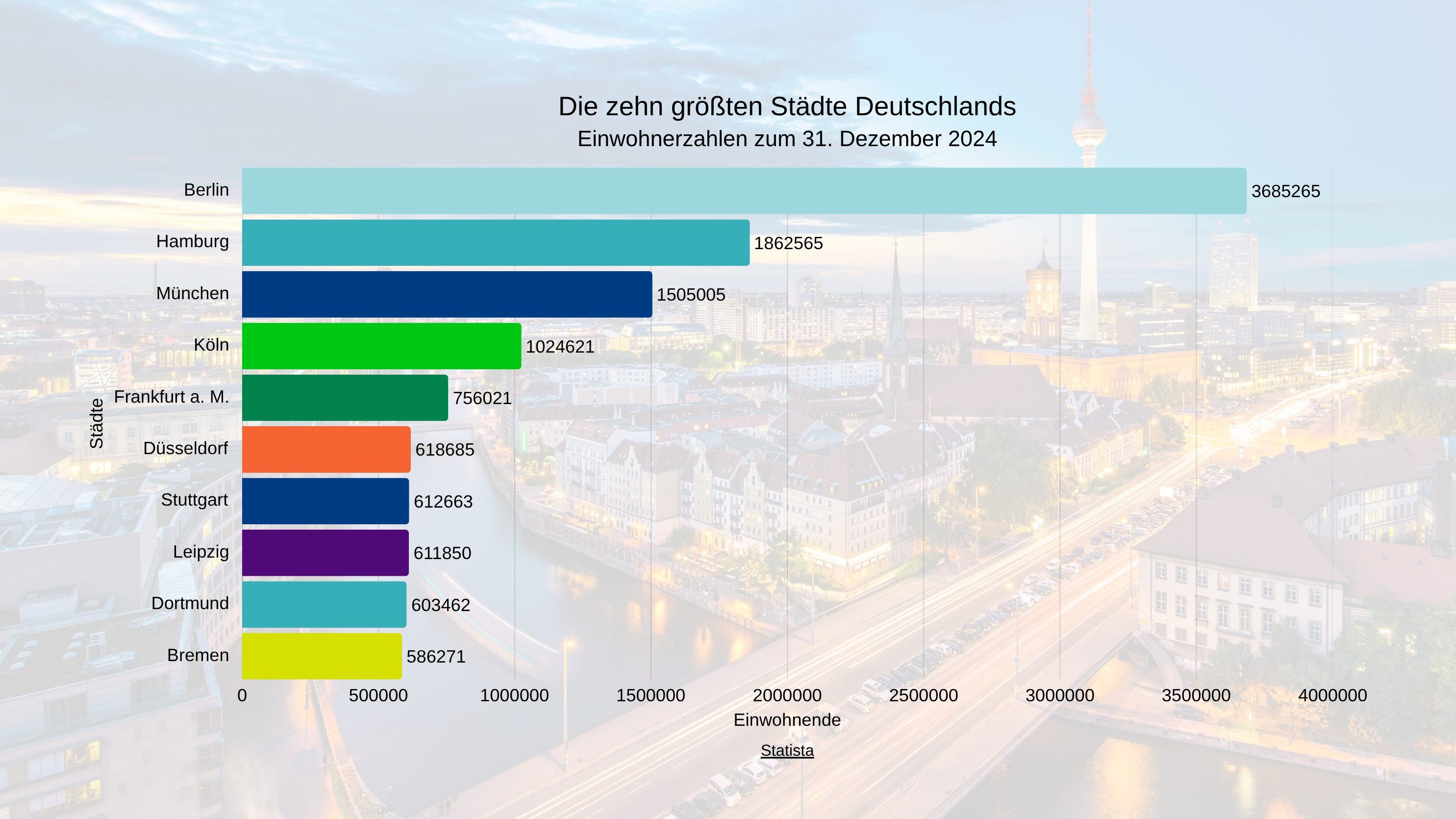
Zwischen Daten, Digitalisierung und Daseinsvorsorge
Intelligente Städte setzen auf digitale Technologien, künstliche Intelligenz und datengetriebene Entscheidungen. Ziel ist es, urbane Räume effizienter, nachhaltiger und widerstandsfähiger zu gestalten. Überlebenswichtig – angesichts der Herausforderungen durch die Folgen des Klimawandels und zunehmende Krisen. Doch Technik allein macht keine Stadt lebenswert.
Was oft übersehen wird: Vertrauen, Teilhabe und soziale Verantwortung sind ebenso entscheidend wie smarte Sensoren oder digitale Plattformen und Vernetzung. Städte brauchen verlässliche Partner, die nicht nur die notwendigen Infrastrukturen bereitstellen, sondern auch Verantwortung übernehmen – für Menschen, Umwelt und Zusammenhalt.
Fünf Prinzipien für menschenzentrierte Stadtentwicklung
Intelligente Stadtentwicklung beginnt bei den Menschen. Sie orientiert sich an ihren Bedürfnissen und schafft Räume bzw. Infrastrukturen, in denen Fortschritt für alle spürbar wird. Fünf Prinzipien sind dabei zentral:
- Lebensqualität als Maßstab
Smarte Lösungen müssen das Leben der Menschen konkret verbessern – sei es durch bessere Mobilität, saubere Energie oder digitale Services, die den Alltag erleichtern. - Beteiligung und Transparenz
Wer mitreden darf, gestaltet mit. Digitale Beteiligungsformate und offene Daten schaffen Vertrauen und ermöglichen echte Mitgestaltung. - Nachhaltige Kreisläufe und resiliente Infrastrukturen
Von der Wasser- und Energieversorgung bis zur Abfallwirtschaft: Infrastruktur muss krisenfest, ressourcenschonend und zukunftsfähig sein. - Verantwortungsvolle Digitalisierung
Der Umgang mit Daten muss transparent und ethisch sein. Nur so bleibt das Vertrauen in digitale Lösungen erhalten. - Soziale Inklusion
Fortschritt darf niemanden ausschließen. Eine smarte Stadt ist eine inklusive Stadt – mit Angeboten für alle Generationen und sozialen Gruppen.

Denn eine smarte Stadt entsteht nicht durch Technik allein. Sie braucht Menschen, die anpacken, mitdenken und mitgestalten. Und sie braucht Partnerschaften, die auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren.
Best Practice: Klimaanpassung sichtbar machen – der Paulusanger in Recklinghausen
Starkregen, überhitzte Plätze, überlastete Kanalisation – die Folgen des Klimawandels sind längst in unseren Städten angekommen. Wie können wir urbane Räume so umbauen, dass sie auch in Zukunft widerstandsfähig und lebenswert bleiben?
Ein konkretes Beispiel aus unserem blau-grünen Kosmos zeigt, wie das gelingen kann: der Paulusanger in Recklinghausen. Gemeinsam mit der Stadt haben unsere Expertinnen und Experten ein innovatives kaskadiertes Mulden-Rigolen-System geplant – ein echtes Vorzeigeprojekt für klimaresiliente Stadtgestaltung.

Der Paulusanger in Recklinghausen: Gemeinsam mit der Stadt hat Gelsenwasser ein innovatives kaskadiertes Mulden-Rigolen-System geplant – ein echtes Vorzeigeprojekt für klimaresiliente Stadtgestaltung.
Die Top 5 Vorteile des Systems:
- Regenwassermanagement: Das System nimmt das Regenwasser der angrenzenden Wohnbebauung auf und verhindert so Überflutungen.
- Natürliche Reinigung und Speicherung: Das Niederschlagswasser wird durch die belebte Bodenzone der Mulden gereinigt und in insgesamt 76 m³ Muldenvolumen sowie 138 m³ Rigolenvolumen gespeichert.
- Gedrosselte Weiterleitung: Das Wasser wird kontrolliert weitergeleitet – ein wichtiger Beitrag zur Entlastung der Kanalisation.
- Flexible Erweiterbarkeit: Weitere Flächen können durch eine einstellbare Abflussdrossel und vorausschauende Dimensionierung problemlos angeschlossen werden.
- Teil eines größeren Konzepts: Das System ist eingebettet in ein umfassendes Regenwasser-Abkopplungskonzept und entlastet die Mischwasserkanalisation nachhaltig.
Unser Ziel: Klimafolgenanpassung sichtbar und erlebbar machen. Dafür denken wir Technik und Stadtgestaltung zusammen, schaffen ökologische Resilienz und erhöhen die Aufenthaltsqualität für die Menschen vor Ort.

„Am Ende bekommen Kommunen eine gute Einschätzung, wo Schäden durch Starkregen entstehen können und welche Bereiche besonders gefährdet sind. Daraus lassen sich dann verwaltungsübergreifende Handlungskonzepte entwickeln, um die Risiken zu mindern und Menschen zu schützen.“
Senay Sereflioglu, Leiterin Kanalinfrastruktur bei der GELSENWASSER AG
Gemeinsam für lebenswerte Städte
Als Infrastrukturunternehmen verstehen wir bei Gelsenwasser unsere Rolle nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich. Wir sind Partner der kommunalen Daseinsvorsorge und damit auch Teil der Transformation unserer Städte. Ob Wasser, Energie, Kreislaufwirtschaft oder digitale Services: Unsere Lösungen sollen nicht nur funktionieren, sondern Verantwortung und Lebensqualität verbinden.
Denn eine smarte Stadt entsteht nicht durch Technik allein. Sie braucht Menschen, die anpacken, mitdenken und mitgestalten. Und sie braucht Partnerschaften, die auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren.
Zum Weltstädtetag 2025 setzen wir als #teamblaugrün ein Zeichen: Für Städte mit Herz und Infrastruktur. Für eine Zukunft, die alle mitnimmt.

